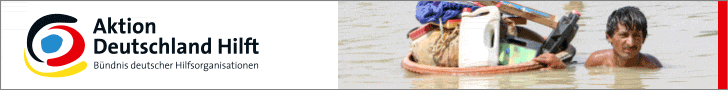Energiewende: Ein Dorf zeigt,wie das geht

Energiewende: Ein Dorf zeigt,wie das geht
ingenieur.de: Mit Solarthermie, Wärmespeichern, einer Wärmepumpe und einem holzbefeuerten Heizkessel hält ein 800-Einwohner-Dorf bereits heute die Umweltnormen des Jahres 2045 ein.
Bracht ist ein typisches Dörfchen. Gut 800 Einwohner, die meisten Häuser sind vor 1980 errichtet, also kaum wärmegedämmt, ebenso wenig wie die Fachwerkhäuser, die einen Anteil von 25 % haben. Bracht, Stadtteil von Rauschenberg im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf, hebt sich dennoch von allen Dörfern in Deutschland ab. Denn es hat sich zum energetischen Vorzeigeobjekt gemausert, ohne dass auch nur ein einziges Haus saniert worden ist. Es erfüllt schon jetzt die energetischen Vorgaben, die in 20 Jahren gelten sollen.
Lesen Sie auch:
Die Investitionen, die das möglich machen, haben 16,3 Millionen Euro verschlungen, pro Gebäude also rund 90.000 Euro. Eine aufwändige Wärmedämmung und die Installation von weitgehend emissionsfreien einzelnen Heizungsanlagen in den 180 Gebäuden des Dörfchens wäre möglicherweise ähnlich teuer geworden. In vielen Fällen wäre eine Wärmedämmung sogar unmöglich oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand machbar gewesen, etwa bei Fachwerkhäusern.
Wie Sommerwärme den Winter erreicht
Ob das „erste Solardorf“ in Hessen nachahmenswert ist? In finanzieller Hinsicht vielleicht nicht, es sei denn, die volkswirtschaftlichen Vorteile werden mitberücksichtigt und der Staat steuert einiges an Geld bei. Aus technischer Sicht ist Bracht dagegen ein Musterbeispiel für die Zukunft.
70 % der benötigten Wärme werden mittels Solarthermie produziert. Die Kollektoren haben eine Fläche von 12.900 Quadratmetern. Da sie vor allem im Sommer produzieren, was im Winter benötigt wird, haben die Initiatoren des Projekts, die eingetragene Genossenschaft Solarwärme Bracht, einen Wärmespeicher eingeplant.
Schwimmende Wärmedämmung
Die Entscheidung fiel zugunsten eines Grubenspeichers, wie er in Dänemark schon genutzt wird. Es handelt sich um einen von Wällen umschlossenen Erdaushub mit einem Volumen von 62.000 Kubikmetern, der mit Folie abgedichtet wird. Darauf schwimmt eine Wärmedämmplatte. Im Sommer wird das im Teich befindliche Wasser aufgeheizt. Wärmepumpen machen die Energie im Winter nutzbar.
In einem gut isolierten 400-Kubikmeter-Pufferspeicher wird Wasser vorgehalten, das direkt in das Nahwärmenetz eingespeist werden kann, um extreme Temperaturschwankungen besser ausgleichen zu können – Wärmepumpen sind nicht sonderlich flexibel. „Die Wärmeverluste großer Saisonalspeicher sind aufgrund ihrer Größe und Geometrie trotz des geringen Einsatzes von Dämmmaterial verhältnismäßig niedrig“, heißt es auf der Homepage des Projekts, das innerhalb von zwei Jahren realisiert wurde.
Grüner Strom statt Blockheizkraftwerk
Um kostengünstigen Strom für die Wärmepumpe zu bekommen war ursprünglich ein Blockheizkraftwerk geplant. Doch es zeigte sich, dass der Bezug von grünem Strom aus dem Netz billiger ist. Dieser Strom unterscheidet sich zwar nicht von normalem Strom.
Der Lieferant muss jedoch nachweisen, dass er die verkaufte Menge umweltneutral produziert, wenn auch nicht unbedingt zum Zeitpunkt der Abgabe. Ein Teil des benötigten Stroms soll von Solarzellen produziert werden, die auf den Wällen des Saisonalspeichers und auf dem Dach des Technikgebäudes installiert werden.
70 % kommen aus der Sonne
Wenn das Wetter besondere Kapriolen schlägt und extreme Kälte beschert springt ein Kessel ein, der mit Holz beheizt wird. Auf einen ursprünglich geplanten erdgasbetriebenen Spitzenlastkessel haben die Planer verzichtet…. weiterlesen